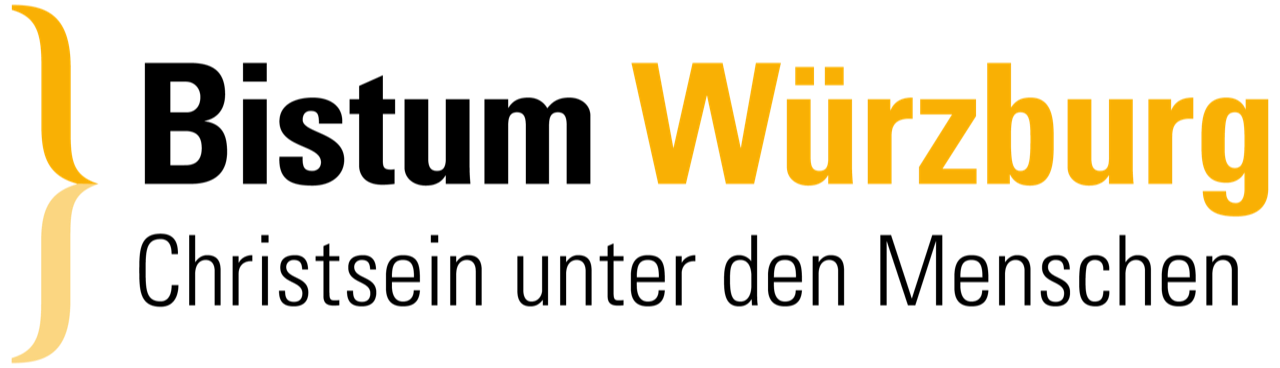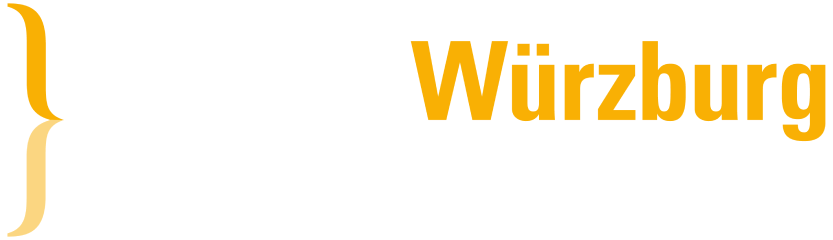Der Innenraum der Spitalkirche St. Jakobus in Karlstadt steckt voller religiöser Symbole, alter und neuer: Auf der nördlichen Seitenwand zum Beispiel stellt ein spätgotisches Fresko den Leidensweg Jesu dar, davor steht ein Metallgestell mit aufgeschichteten Holzscheiten, eine „Wand der Klage“, in deren Zwischenräume Besucher Botschaften hinterlassen können. Auf der gegenüberliegenden Seitenwand kämpft der Erzengel Michael auf einem ehemaligen Altarbild gegen das Böse und um die Seelen, davor stehen mächtige Holzstämme, auf denen Messingtafeln an Angehörige oder an Mitglieder von Vereinen erinnern. Und schließlich der Hochaltar mit dem Altarbild des Heiligen Wandels, die heilige Familie auf einem Spaziergang unter dem Schutz Gottes und geführt vom Heiligen Geist, und der Figur des Pilger- und Kirchenpatrons und Pilgerheiligen Jakobus. „Leben ist Pilgerschaft hin zur Vollendung im Leben Gottes“, sagt Pfarrer Simon Mayer, der sich seit Jahren mit der Spitalkirche beschäftigt.
Bürgerschaftliches Engagement
Die Spitalkirche ist eine der vielen Nebenkirchen im Bistum Würzburg, deren Zukunft lange ungewiss war. „Als ich 2015 kam, stand schon länger die Frage im Raum, was wir damit machen“, erinnert sich Pfarrer Mayer. Es habe immer wieder Ideen oder auch Anfragen freichristlicher Gemeinden zur Nutzung gegeben, allerdings sei die Kirchenstiftung „eher ratlos“ gewesen. „Ich habe mich immer wieder in das Thema reinmeditiert“, erzählt der Karlstädter Pfarrer. Zum Glück seien das Dach dicht und die Raumschale soweit intakt gewesen. Die „gute Patina“ der Kirche habe er nicht zerstören wollen, auch wenn die ein oder andere Stelle an Wänden und Decke auf Feuchtigkeit hinweist.
Pfarrer Mayer war wichtig, dass die Umnutzung ohne große Kosten über die Bühne geht. Deshalb ließ er das Diözesanbauamt außen vor und setzte sich dafür ein, dass die Kirche nicht kategorisiert wird. „Mir ging es mehr um bürgerschaftliches Engagement, damit sich die Menschen mit der Kirche identifizieren“, sagt Mayer. Obwohl die Altstadtpfarrei, also im Wesentlichen der Bereich zwischen Main und Bahnschienen, nur noch rund 800 Katholiken umfasst, sei die Unterstützung durch Spenden und tatkräftiger Mithilfe groß gewesen.
Festakt zum Abschluss
Herausgekommen ist ein inspirierender Ort des Trauerns und Gedenkens mitten in Karlstadt. Dass das alles in allem zehn Jahre gedauert hat, sieht der Pfarrer entspannt: „Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich sage: Der Raum ist fertig“, begründet er die Entscheidung, für Montag, 21. Juli, zu Sektempfang und Festakt einzuladen, um sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Kunstreferent Dr. Jürgen Emmert wird dabei einen Vortrag über die Spitalkirche halten, zudem soll ein letztes Ausstattungsstück übergeben werden.
Die Spitalkirche St. Jakobus neben dem Oberen Tor in Karlstadt ist die Kirche des ehemaligen Spitals, das sich auf der anderen Seite der Hauptstraße befand und längst abgerissen ist. Die Kirche wurde im Jahr 1438 erbaut und unter Fürstbischof Julius Echter 1608 bis 1610 erhöht und mit einem prächtigen Renaissanceportal versehen. Die Spuren dieser nachträglichen Veränderung sind bis heute zu erkennen. „Die Kirche ist ein architektonisches und kunstgeschichtliches Kleinod in der Stadt Karlstadt“, sagt Pfarrer Simon Mayer. Das sei auch an der großen Zahl der Touristen abzulesen, die im Sommer die Kirche besuchen. Der Kerzenständer vor dem Altar sei oft am Abend voll.
Monatliches Trauer-Requiem
Früher habe es nur noch vereinzelt Gottesdienste hier gegeben, vor allem natürlich zum Jakobustag am 25. Juli. Mittlerweile sei die Spitalkirche von der Karwoche bis Allerseelen fest im Gemeindeleben des Pastoralen Raums verankert. Das beginne am Abend des Karfreitages mit einer Grablegeprozession von der Stadtpfarrkirche St. Andreas zur Spitalkirche. In der Ende der 1990er Jahre renovierten Kirche werde dann ein Heiliges Grab aufgebaut. Bis Allerseelen finde jeden ersten Sonntag im Monat hier ein Trauer-Requiem für die Verstorbenen des Pastoralen Raumes Karlstadt statt. Im Winter müsse das in St. Andreas verlegt werden, weil die Spitalkirche nicht beheizt werde und deshalb im Winter „knackig kalt“ sei. Ehrenamtliche sorgen zudem dafür, dass die kleine Kirche in der Hauptstraße jeden Tag geöffnet wird.
„Theologie des Raumes“
Pfarrer Simon Mayer hat sich intensiv mit der „Theologie des Raumes“ beschäftigt und sie an einigen Stellen auch ergänzt: Vor dem barocken Seitenaltar (ursprünglich aus der Stadtkirche St. Andreas) mit der Darstellung der Marter des heiligen Sebastian, den Pestheiligen Vitus und Rochus im Gebälk, sowie dem Tod des heiligen Josef auf der Altarmensa steht zum Beispiel ein schwarz gefasstes, den inneren Teil nach hinten gebogenes Altarkreuz. „Es macht deutlich: Wir sind im Leben vom Tod umfangen“, sagt Mayer. Deshalb stehe davor auch die Wand der Klage, durch die sich Besucher Leiden, Trauer, Not und Sorgen wortwörtlich von der Seele schreiben und bei Gott zurück lassen könnten.
Auf der rechten Seite ist ein prunkvoll gerahmtes Marienbild zu sehen. „Maria als erster Mensch, der mit Leib und Seele die Vollendung im Leben Gottes erhalten hat“, beschreibt Mayer die Darstellung. Der barocke Seitenaltar rechts stammt ebenfalls aus der Stadtkirche St. Andreas und zeigt ein Allerheiligenbild. Nach den Worten von Pfarrer Mayer eine „Darstellung derer, von denen wir glauben, dass sie die Vollendung im Leben Gottes erhalten haben“. Das verdeutliche auch das Medaillon mit dem auferstandenen Christus und den modernen Engeln, deren Flügel an Pflanzen erinnern. Das moderne Altarkreuz davor ist golden gefasst und der Innenteil wölbt sich nach vorne heraus. Mayer: „In der Auferstehung wird das Leben befreit.“
In der Mitte des Raumes befinde sich die feiernde Gemeinde, um die Orte der Gegenwart Christi, Altar und Ambo. Und mit den Messingtafeln an den Baumstämmen würden auch die Verstorbenen in die Feiern aufgenommen.
Von Ralf Ruppert